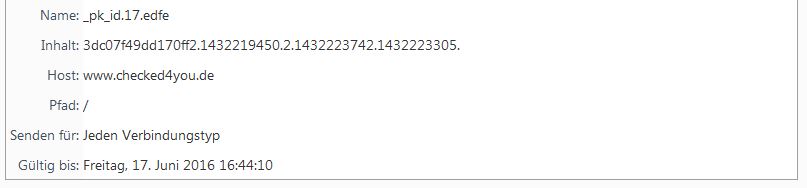Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat im Bundestag ein Gesetz zur „Verbesserung der Transparenz und der Bedingungen beim Scoring (Scoringänderungsgesetz, PDF)“ eingebracht. Mit diesem Gesetz zur Änderung verschiedener Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) möchte die Fraktion laut der Gesetzesbegründung
„insbesondere die Transparenz des statistischen Analyseverfahrens beim Scoring“
grundlegend verbessern werden.
Die Ausgangslage
Der Gesetzesentwurf referenziert unter anderem auf eine Studie des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein und der GP Forschungsgruppe aus dem Jahre 2014. Beeinflusst ist der Gesetzesentwurf freilich auch durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahre 2014 (VI ZR 156/13), in dem es um den Auskunftsanspruch von Prsonen gegenüber der SCHUFA ging und das Gericht entschied, dass
die sogenannte Scoreformel, also die abstrakte Methode der Scorewert berechnung
der Auskunft suchenden Person nicht mitzuteilen ist. Ebenso wenig erstrecke sich der Auskunftsanspruch auf solche Inhalte der Scoreformel, die als Geschäftsgeheimnisse schützenswert sind.
Der Gesetzesentwurf
Nachfolgend möchte ich knapp auf einige Änderungsvorschlage des Gesetzesentwurfs eingehen.
Es soll eine generelle Pflicht der Vorabkontrolle beim Angebot von Scoringverfahren eingefügt werden (§ 4d Abs. 5 S. 2 BDSG-E). Diese Pflicht soll, anders als die bestehende Vorabkontrollverpflichtung, unabhängig davon bestehen, ob eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Verarbeitung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. Zuständig für die Vorabkontrollen ist innerhalb von Unternehmen, wie auch jetzt, der Datenschutzbeauftragte.
Die Informationspflichten im Rahmen der Meldepflicht (und damit des Verfahrensverzeichnisses) sollen um einen neuen Punkt erweitert werden (§ 4e Abs. 1 Nr. 10 BDSG-E). Nach der Nr. 10 sollen im Fall des Scoring „eine Beschreibung des wissenschaftlich anerkannten mathematischstatistischen Verfahrens sowie Angaben zu § 28b Nummer 4“ erfolgen. Nach dem Gesetzesentwurf liegt der Zweck der Meldung darin, die eine Prüfung der Zulässigkeit der beabsichtigten Verfahren zu ermöglichen. Nicht erwähnt wird in dem Entwurf jedoch eine Anpassung von § 4g Abs. 2 S. 2 BDSG, wonach der Datenschutzbeauftragte nur die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar machen muss. Informationen zum anerkannten mathematischstatistischen Verfahren sollen also nicht im öffentlichen Verfahrensverzeichnis erwähnt werden.
Natürlich soll auch der § 28b BDSG geändert werden, der derzeit die Zulässigkeit von Scoring-Verfahren regelt. § 28 BDSG gibt vor, was zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswertes genutzt und nicht genutzt werden darf. Nach dem neuen § 28b Abs. 1 Nr. 4 BDSG-E darf ein Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen erhoben oder verwendet werden, wenn
für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts zum Zwecke der Bonität keine Anschriftendaten, Daten aus sozialen Netzwerken, Daten aus Internetforen, Angaben zur Staatsangehörigkeit, zum Geschlecht, zu einer Behinderung oder Daten nach § 3 Absatz 9 genutzt werden.
Explizit soll also eine Verwendung von besonderen Arten personenbezogener Daten (z.B. Gesundheitsdaten) ebenso ausgeschlossen werden, wie ein Rückgriff auf Informationen aus „sozialen Netzwerken“ und „Internetforen“. Der Praktiker wird sich fragen: Was ist damit gemeint? Die Begründung definiert „Soziale Netzwerke“ und “Internetforen“ als
Plattformen, auf denen z.B. Kontakte, Meinungen, Interessen und das Einkaufsverhalten der betroffenen Personen mitgeteilt werden.
Plattformen auf denen Meinungen und Interessen mitgeteilt werden. Man möchte sich gar nicht ausmalen, was man (bei einer weiten Auslegung) alles hierunter fassen könnte.
Zudem soll eine neue § 28b Abs. 1 Nr. 5 BDSG-E eingefügt werden. Die Verwendung des Wahrscheinlichkeitswertes wird davon abhängig gemacht, dass
der Betroffene vor Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene Nutzung seiner Daten schriftlich unterrichtet worden ist. Die Unterrichtung ist zu dokumentieren. Soll die Unterrichtung zusammen mit anderen Erklärungen erfolgen, ist sie besonders hervorzuheben.
Dies bedeutet: bevor überhaupt irgendeine Datenverarbeitung hinsichtlich des Wahrscheinlichkeitswertes beginnen kann, muss der Betroffene schriftlich(!) informiert werden. Dies soll auch innerhalb von AGB möglich sein, jedoch dann deutlich hervorgehoben. Hier grüßt meines Erachtens der Medienbruch. Denn in dem bisher geltenden § 28b Nr. 4 BDSG ist auch allein von „Unterrichtung“ die Rede. Schriftlich muss diese nicht erfolgen.
Zudem soll ein neuer § 28b Abs. 2 BDSG-E vorgeben, dass das wissenschaftlich anerkannte mathematisch-statistische Verfahren muss dem Stand der Wissenschaft und Forschung entsprechen muss. Wie genau dieser Stand aussieht, dies überlässt der Gesetzesentwurf der Bundesregierung, die hierzu durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats Vorgaben machen kann.
Auch die Weite des Auskunftsanspruchs soll vergrößert werden. Nach dem neuen § 34 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BDSG-E ist Auskunft zu erteilen, über
die verwendeten Einzeldaten, die Gewichtung der verwendeten Daten, die verwendeten Vergleichsgruppen und die Zuordnung der betroffenen Personen zu den Vergleichsgruppen, die in die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts einfließen.
Ein solcher Umfang des Auskunftsanspruches ist derzeit nicht vorgesehen.
U
nd noch eine weitere wichtige Änderung soll im Rahmen des Auskunftsanspruchs geregelt werden. § 34 Abs. 2 S. 2 BDSG-E sieht vor, dass der Zugang zu diesen Informationen nicht
unter Berufung auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis abgelehnt werden“
kann. Diese Änderung referenziert direkt auf das oben erwähnte Urteil des BGH, mit dem die Verfasser des Gesetzentwurfs nicht einverstanden sind und folglich eine gesetzgeberische Anpassung vorschlagen. Interessant ist folgende Klarstellung in der Gesetzesbegründung:
Verlangt werden kann nicht die Offenlegung … des zugrunde liegenden Algorithmus.
Ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Unternehmen erkennt der Gesetzesentwurf nicht an. Auch ein unzulässiger Eingriff in das Grundrecht auf Berufsfreiheit in Art. 12 Abs. 1 GG der Scoring-Verwender lehnt die Gesetzesbegründung ab.
Der Gesetzesentwurf sieht noch weitere Änderungen vor. Unter anderem soll eine jährliche Auskunftspflicht (!) der Auskunfteien eingeführt werden.
Zudem soll eine Pflicht für die zuständigen Landesdatenschutzbehörden eingeführt werden, Unternehmen, die Scoring-Verfahren verwenden, mindestens einmal jährlich zu kontrollieren (§ 38 Abs. 1 S. 2 BDSG-E). Hierbei handelt es sich um eine „Sollpflichtprüfung“. Dies bedeutet, dass die Aufsichtsbehörden grundsätzlich prüfen müssen, es sei denn es liegen besondere Umstände vor. Bei der derzeitigen Ausstattung (finanziell als auch personell) der Behörden, darf man sich doch die Frage stellen, inwieweit eine solche Pflicht eventuell weite Teile einer Behörde binden und damit lähmen könnte. Denn eine Prüfung sollte wenn sie denn schon durchgeführt wird doch umfassend erfolgen und nicht etwa als eine Art „Feigenblatt“ dienen. Dies erfordert dann aber auch einigen Einsatz an Personal und Zeit.
Fazit
Es bleibt abzuwarten, inwieweit der vorliegende Gesetzesentwurf im Gesetzgebungsverfahren noch Änderungen erfahren wird und ob sich die Opposition hier gegenüber der Koalition durchsetzen kann. Zudem muss freilich auf die sich bereits abzeichnende Einigung bei der Datenschutz-Grundverordnung hingewiesen werden, die dann Gesetzesnormen schafft, die den hier entstehenden Regelungen grundsätzlich vorgehen.